Scheu will auf ihrer kleinen Farm eigentlich nur ihre blutige Vergangenheit hinter sich lassen. Doch dann werden ihre beiden Geschwister entführt. Zusammen mit ihrem Stiefvater Lamm macht sie sich auf den Weg durch ein vom Goldrausch heimgesuchtes Land, um Bruder und Schwester zurück nach Hause zu holen.
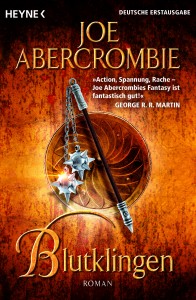 Wie der Klappentext schon vermuten lässt, ist Joe Abercrombies Blutklingen kein klassischer Fantasyroman. Abercrombie verlegt seine Geschichte in ein trostloses Niemandsland, das an den Beginn des Wilden Westen Amerikas im 19. Jahrhundert denken lässt. An ein Fantasy-Setting erinnern nur noch die Schwerter an den Gürteln, die aber langsam von Schießpulver und Bomben abgelöst werden. Magie spielt eine so untergeordnete Rolle, dass der Leser sich nicht sicher sein kann, ob es wirklich Magie ist oder einfache Taschenspielertricks.
Wie der Klappentext schon vermuten lässt, ist Joe Abercrombies Blutklingen kein klassischer Fantasyroman. Abercrombie verlegt seine Geschichte in ein trostloses Niemandsland, das an den Beginn des Wilden Westen Amerikas im 19. Jahrhundert denken lässt. An ein Fantasy-Setting erinnern nur noch die Schwerter an den Gürteln, die aber langsam von Schießpulver und Bomben abgelöst werden. Magie spielt eine so untergeordnete Rolle, dass der Leser sich nicht sicher sein kann, ob es wirklich Magie ist oder einfache Taschenspielertricks.
Auch die Geschichte selbst folgt keinem Fantasy-Schema. Wie auch in seinen vorherigen Büchern muss kein Held die Welt vor dem ultimativ Bösen retten. Es geht um den ganz persönlichen Kampf ums Überleben, um Recht und darum manchmal das Richtige zu tun. Und genau darin liegt die Stärke von Abercrombies Büchern, und auch von Blutklingen: Seine Charaktere und ihr ganz eigenes Ringen um ihr Leben.
Bei Abercrombie gibt es kaum reines schwarz oder weiß. Auch wenn es auf jeden Fall deutlich mehr Böses als Gutes gibt. Der selbstverliebte Söldneranführer Cosca, der für Geld alles macht und der fanatische Inquisitor Lorsen, dem jedes Mittel recht ist, um die Rebellen auszurotten, sind die beiden dunkelsten Charaktere, die man am ehesten noch als böse einordnen könnte. Ab da wird es schwammiger. Auch die Hauptcharaktere sind keine edlen Ritter in strahlender Rüstung. Scheu versucht ihre brutale Vergangenheit hinter sich zu lassen und hat ihre Hand stets an ihrem Messer. Ihr Stiefvater Lamm wird von Seite zu Seite düsterer und brutaler. Doch beide sind auf der hehren Mission die entführten Geschwister zurückzuholen. „Heiligt der Zweck die Mittel?“ ist eine der Fragen, die die Geschichte von Anfang bis Ende begleiten. Dementsprechend blutig und brutal sind Abercrombies Bücher. Sinnloser Mord und Totschlag sind allgegenwärtig. Man kann seine Bücher weniger als Fantasy-Romane, sondern mehr als Studie einer hoffnungslosen Menschlichkeit lesen, die händeringend versucht, das Richtige zu tun, aber immer wieder in den Morast der Gewalt zurückgeworfen wird.
Dafür liebe ich Abercrombie. Für Dreck und Gewalt und Charaktere, denen man trotz all ihrer Fehler endlich das ersehnte Glück wünscht. Das Setting Comboy und Indianer gefällt mir aber nicht. Ich mag es, wenn sich Fantasy aus dem dunklen Mittelalter langsam in die Neuzeit bewegt. Die Feuerreiter seiner Majestät von Naomi Novik sind wunderbar unterhaltsame Bücher, die die Kolonialzeit mit Drachen würzen. Auch Michael A. Stackpole siedelt seine Königliche-Kolonien-Reihe in dieser Zeit an und bleibt dabei erstaunlich nah an den wahren historischen Begebenheiten. Bei Abercrombie tauchen die Indianer nur als kleine Episode auf und verschwinden dann auf nimmer Wiedersehen. Wirkliches Wild West Feeling kommt nicht auf. Auch wenn die Charaktere mit Wagen durch die Prärie ziehen und in Eimer spucken. Eventuell hängt an Abercrombies Charakteren einfach zu sehr das Fantasy-Gefühl, weil man viele von ihnen aus seinen anderen Büchern bereits kennt, sodass kein Raum mehr für neue Zeiten ist. Und: Sowohl Covergestaltung als auch Titelübersetzung sind einfach grauenhaft. Aber dafür kann der Autor ja nichts.
Autor: Joe Abercrombie
Originaltitel: Red Country
Verlag: Wilhelm Heyne Verlag, München
Ausgabe: Deutsche Erstausgabe 05/13
ISBN: 978-3-453-31483-2
